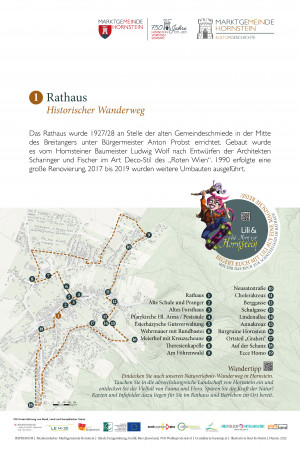Geologie
Das große Gemeindegebiet von Hornstein ist geologisch abwechslungsreich und teilweise auch recht kompliziert gebaut. Die höchste Erhebung des Gemeindegebietes, der Sonnenberg (483 m), besteht aus Graniten und Granitgneisen, die einen 2 km langen Westnordwest-Ostsüdost gestreckten Rücken aufbauen. Die Kuppe des Schlossbergs (446m) bildet das westliche Ende dieses Granitrückens. Das größte Leithakalkgebiet nimmt den gesamten Osten des Gemeindegebietes bis zu einer Linie ein, die an der nördlichen Gemeindegrenze beginnt, dann nach Süden weiterführt, um bei der Kürschnergrube die südliche Gemeindegrenze zu erreichen. In der Kürschnergrube wurden einst durch Schrämmarbeit Werksteine eines witterungsbeständigen Leithakalksandsteins gewonnen.

Der flachwellige Hangfuss des Leithagebirges gegen die Leithaniederung hin wird durchwegs von pannonischen Sedimenten aufgebaut. Diese bilden im Südteil der Hartläcker einen Sandsteinkomplex aus Quarzsand, der von Mergeln unterlagert wird. Kalksandsteine finden wir ferner im Bereich der südlichen Steinvierteläcker und in großer Verbreitung am Nordhang des Lebzelterberges, wo sie die nördliche Gemeindegrenze begleiten. Die tonig-mergelige Schicht wurde im Bereich des Nordrandes des Neufelder Sees auf Hornsteiner Gemeindegebiet durch den großen, heute stilliegenden Braunkohlenbergbau erschlossen. Aus dem heute als Neufelder See bekannten, ertrunkenen Braunkohlenbergbau wurden schätzungsweise 5,5 Millionen Tonnen Kohle gefördert, davon rund die Hälfte auf Hornsteiner Gemeindegebiet.
Die pannonischen Sedimente werden von Terrassenschottern der Leitha großflächig bedeckt. Eine eingeschotterte, vielfach zerschnittene Terrasse von 240-200m Seehöhe läßt sich durch das ganze Gemeindegebiet von den Hartläckern im Süden bis zu den Holbitzaäckern im Norden verfolgen. Schottrig-sandiges Jungquartär begleitet die Leitha und bildet an der Landesgrenze bedeutende Anteile des Gemeindegebietes (Lange Wiesen, Flachland zwischen Minibach und Leitha).